Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) ist mehr als nur eine Umweltpolitik – sie ist ein Marktzugangsfilter, der den Welthandel bald neu definieren wird. Ab Ende 2025 müssen Unternehmen, die wichtige Rohstoffe in die EU importieren oder exportieren, nachweisen, dass ihre Produkte entwaldungsfrei, legal produziert und vollständig rückverfolgbar sind. Verstöße können zu Geldstrafen, Produktverboten oder sogar zum Ausschluss vom EU-Markt führen. Dieser Artikel erläutert, was die EUDR für Unternehmen bedeutet, welche Produkte betroffen sind und wie Sie sich auf diese kritische Regulierungsänderung vorbereiten können.
Die Europäische Entwaldungsverordnung (EUDR) ist eines der ehrgeizigsten Nachhaltigkeitsgesetze, die die EU je verabschiedet hat. Für Unternehmen, die in der EU tätig sind oder dorthin exportieren, ist sie mehr als nur eine weitere Compliance-Anforderung. Sie stellt einen bedeutenden operativen Wandel dar, der Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Rechenschaftspflicht entlang komplexer globaler Lieferketten erfordert.
Da die Umsetzung Ende 2025 beginnt, müssen Unternehmen, die mit bestimmten Rohstoffen und deren Derivaten handeln, jetzt handeln, um sich vorzubereiten. Dieser Artikel erläutert alles Wissenswerte über die EUDR: Was sie ist, wen sie betrifft, was die Einhaltung beinhaltet und wie Sie sich noch heute darauf vorbereiten können.

Was ist die EUDR und warum wurde sie eingeführt?
Die EU-Verordnung soll sicherstellen, dass Produkte, die auf den EU-Markt gebracht oder aus der EU exportiert werden, nicht mit Abholzung oder Waldschädigung in Verbindung stehen. Sie gilt für wichtige Rohstoffe, die häufig mit Umweltschäden in Verbindung gebracht werden, darunter Rinder, Soja, Palmöl, Holz, Kakao, Kaffee und Kautschuk.
Das Gesetz wurde verabschiedet, um die Rolle der EU bei der globalen Abholzung zu reduzieren und umfassendere Klima- und Biodiversitätsziele zu unterstützen. Es ist Teil des Green Deal der EU und ergänzt andere Initiativen wie die Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeitssorgfaltspflicht (CSDDD) und die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD).
Diese Verordnung unterscheidet sich von früheren Bemühungen, indem sie über die Legalität hinausgeht und konkrete Nachweise dafür verlangt, dass die Produkte frei von Abholzung sind. Sie berücksichtigt auch Menschenrechtsaspekte, darunter die Achtung der Landnutzungsrechte indigener Völker.
Wer muss die EUDR einhalten?
Die EUDR gilt für zwei Hauptkategorien von Wirtschaftsakteuren:
- Betreiber: Unternehmen oder Einzelpersonen, die ein relevantes Produkt erstmals auf dem EU-Markt in Verkehr bringen oder aus der EU exportieren.
- Händler: Alle Personen in der Lieferkette (mit Ausnahme der Marktteilnehmer), die das betreffende Produkt auf dem EU-Markt bereitstellen.
Wenn Sie Produkte handeln, verkaufen, importieren oder exportieren, die mit den in der EU-Verordnung aufgeführten Waren in Zusammenhang stehen, unterliegen Sie wahrscheinlich deren Anforderungen. Auch wenn Sie nicht direkt Betreiber oder Händler sind, benötigen Ihre Kunden möglicherweise Unterlagen oder Daten von Ihnen, um ihren Sorgfaltspflichten nachzukommen.
Wichtig: Während große Unternehmen die Vorschriften bis zum 30. Dezember 2025 einhalten müssen, haben Kleinst- und Kleinunternehmen bis zum 30. Juni 2026 Zeit. Die Anforderungen bleiben jedoch für alle streng, und eine frühzeitige Vorbereitung wird dringend empfohlen.
Welche Produkte und Waren sind abgedeckt?
Die EUDR zielt auf sieben risikoreiche Rohstoffe und eine breite Palette daraus gewonnener Produkte ab. Dazu gehören:
- Vieh: Die Viehzucht ist eine der Hauptursachen für die Abholzung von Wäldern, insbesondere in Lateinamerika, wo große Waldflächen für Weideland gerodet werden. Dazu gehören lebendes Vieh, frisches und gefrorenes Fleisch, essbare Innereien, Häute, Felle und Lederprodukte.
- Kakao: Kakaoplantagen haben in Westafrika und Südostasien zu großem Waldverlust geführt. Umfasst Kakaobohnen, Schalen, Paste, Butter, Pulver und Schokoladenprodukte.
- Kaffee: Kaffeeanbau führt zur Fragmentierung von Lebensräumen und zum Verlust der Artenvielfalt, insbesondere bei sonnenbasierten Anbaumethoden. Gerösteter Kaffee, entkoffeinierter Kaffee, Schalen und Häute, Kaffeeersatz.
- Ölpalme: Palmöl ist aufgrund der großflächigen Plantagenentwicklung eine Hauptursache für die Abholzung der Wälder in Indonesien und Malaysia. Palmöl, Palmkernöl, Glycerin, Fettsäuren, industrielle Oleochemikalien.
- Gummi: Durch die Expansion des Kautschukanbaus wurden vielfältige Naturwälder durch Monokulturplantagen ersetzt. Rohkautschuk, Reifen, Riemen, Schläuche, industrielle Gummiprodukte.
- Soja: Großflächiger Sojaanbau treibt die Abholzung der Wälder in Brasiliens Amazonas- und Cerrado-Regionen voran. Sojabohnen, Mehl, Schrot, Öl, Ölkuchen.
- Holz: Nicht nachhaltiger Holzeinschlag stellt eine anhaltende Bedrohung für die Primärwälder weltweit dar. Umfassende Abdeckung von Brennholz bis hin zu fertigen Möbeln, einschließlich Zellstoff, Papier und Fertighäusern.
Die Produkte werden anhand der EU-Zollcodes (KN) identifiziert, die in Anhang I der Verordnung aufgeführt sind. Ist der Code eines Produkts nicht aufgeführt, kann es von der Zollpflicht ausgenommen sein. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
Wichtige Anforderungen für die Einhaltung
Um ein entsprechendes Produkt auf dem EU-Markt in Verkehr zu bringen oder zu exportieren, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
- Abholzungsfrei: Das Produkt darf nicht mit Flächen in Verbindung stehen, die nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzt wurden.
- Legal hergestellt: Das Produkt muss allen geltenden Gesetzen des Herkunftslandes entsprechen, einschließlich Umwelt-, Arbeits- und Landnutzungsgesetzen.
- Due-Diligence-Erklärung: Unternehmen müssen über ein zentrales EU-Informationssystem eine formelle Erklärung zur Bestätigung der Einhaltung einreichen.
Was ist Due Diligence gemäß der EUDR?
Die Sorgfaltspflicht steht im Mittelpunkt der Verordnung. Unternehmen müssen ein robustes System einrichten, um:
- Informationen sammeln: Erfassen Sie Daten zur Herkunft der Waren, zu Lieferantenidentitäten, zu Geolokalisierungskoordinaten von Produktionsflächen und zum Volumen.
- Risikobewertung: Bewerten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt aus abgeholzten Wäldern stammt oder gegen lokale Gesetze verstößt.
- Risiken minimieren: Wenn das Risiko mehr als vernachlässigbar ist, ergreifen Sie vor der Markteinführung Maßnahmen, um es zu beseitigen oder zu reduzieren.
Zur Risikominderung könnte Folgendes gehören:
- Anfordern zusätzlicher Unterlagen von Lieferanten.
- Durchführung unabhängiger Audits oder Standortinspektionen.
- Mithilfe von Waldüberwachungstechnologie oder Satellitendaten.
Geolokalisierung und Rückverfolgbarkeit
Im Rahmen der EU-Verordnung ist die Geolokalisierung keine bloße Formalität – sie ist einer der technisch anspruchsvollsten und rechtlich kritischsten Aspekte der Compliance. Die Rückverfolgbarkeit bis zum genauen Grundstück, auf dem ein Rohstoff angebaut oder geerntet wurde, bildet die Grundlage für den Nachweis, dass Produkte ohne Abholzung hergestellt wurden. Im Gegensatz zu vielen früheren Vorschriften, die auf Papierkram oder Lieferantenerklärungen beruhten, schreibt die EU-Verordnung überprüfbare, räumlich präzise Daten vor, die jede Warencharge mit ihrem physischen Ursprungsort verknüpfen.
Warum Geolokalisierung rechtlich unerlässlich ist
Die Begründung für diese Anforderung ist einfach: Um nachzuweisen, dass nach dem Stichtag 31. Dezember 2020 keine Abholzung stattgefunden hat, müssen die EU-Behörden die Landhistorie unabhängig bestätigen können. Das bedeutet, dass jeder Akteur der Lieferkette – vom Kleinbauern bis zum globalen Exporteur – die genauen geografischen Koordinaten jedes an der Produktion der betroffenen Rohstoffe beteiligten Grundstücks erfassen und bereitstellen muss.
Diese Koordinaten, oft in Dezimalgraden (WGS84-Format) angegeben, ermöglichen es den Strafverfolgungsbehörden, mithilfe von Satellitenüberwachungsinstrumenten Landnutzungsänderungen im Laufe der Zeit zu erkennen. Ziel ist es, Unklarheiten durch die Bereitstellung belastbarer, standortbezogener Beweise zu beseitigen, die aus der Ferne überprüft und mit Abholzungswarnungen, Waldschädigungskarten oder satellitengestützten Bildarchiven abgeglichen werden können.
Doch es geht nicht nur um den Standort. Neben den Grundstückskoordinaten müssen Unternehmen weitere Daten erfassen: die Größe der Landfläche, die Art des angebauten Produkts, die Identität des Landwirts oder Lieferanten sowie den genauen Zeitpunkt der Ernte bzw. Produktion. Diese Daten müssen sicher gespeichert und den Aufsichtsbehörden mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung gestellt werden, um Rückverfolgbarkeit und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.
Operative Herausforderungen in realen Lieferketten
Die Implementierung von Geolokalisierung im großen Maßstab ist nicht ohne Komplikationen. Viele vorgelagerte Produzenten, insbesondere in tropischen Regionen oder ländlichen Gebieten, verfügen nicht über den Zugang zu GPS-Geräten oder die erforderlichen digitalen Kenntnisse zur Erfassung genauer Koordinaten. In manchen Fällen ist der Landbesitz informell oder nicht dokumentiert, was die Überprüfung des Rechtsstatus des Produktionsstandorts erschwert. Landwirtschaftliche Praktiken wie Fruchtwechsel, Zwischenfruchtanbau oder die gemeinsame Landnutzung durch mehrere Kleinbauern erschweren die Rückverfolgbarkeit zusätzlich.
Die Fragmentierung globaler Lieferketten erhöht die Komplexität zusätzlich. Ein EU-Importeur bezieht möglicherweise Kakao oder Kaffee von Dutzenden oder sogar Hunderten von Bauern, die jeweils mehrere Parzellen bewirtschaften. Die Koordination dieser Datenerfassung – und zwar zuverlässig, konsistent und revisionssicher – erfordert ein Maß an Systematisierung, für das viele Unternehmen noch nicht gerüstet sind.
Strategische Lösungen für Compliance
Um die Rückverfolgbarkeitsanforderungen der EUDR zu erfüllen, müssen Unternehmen proaktiv und technologiebasiert vorgehen. Dies beinhaltet häufig die Integration der Erfassung von Geolokalisierungsdaten in die landwirtschaftlichen Arbeitsabläufe durch mobile Tools, Schulungsprogramme für Landwirte oder technische Unterstützung vor Ort. In manchen Fällen kann der Einsatz externer Außendienstteams oder die Zusammenarbeit mit Genossenschaften und lokalen Verbänden helfen, Kapazitätslücken zu schließen.
Fortschrittlichere Lieferketten setzen zunehmend satellitengestützte Plattformen zur Waldüberwachung ein, die Landnutzungsänderungen in Echtzeit verfolgen können. Andere implementieren digitale Systeme zur Lieferkettenkartierung, die mit bestehenden ERP- oder Beschaffungssystemen verknüpft sind und so die Erfassung von Geolokalisierungs- und Beschaffungsdaten am Verkaufsort sicherstellen. In besonders komplexen oder risikoreichen Beschaffungsumgebungen können Blockchain- oder QR-basierte Rückverfolgbarkeitssysteme eine manipulationssicherere und transparentere Lösung bieten.
Unabhängig vom Technologie-Stack bleibt das Ziel dasselbe: eine zuverlässige, überprüfbare Verbindung zwischen dem Produkt und seinem Herkunftsland herzustellen – und sicherzustellen, dass diese Daten einer externen Prüfung standhalten. Unternehmen, die frühzeitig in solche Rückverfolgbarkeitssysteme investieren, reduzieren nicht nur ihr Compliance-Risiko, sondern erzielen auch langfristige Vorteile in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, der Stakeholder-Transparenz und der Markenintegrität.

Vereinfachte Due Diligence für Länder mit geringem Risiko
Die Europäische Entwaldungsverordnung (EUDR) sieht einen risikobasierten Rahmen vor, der vereinfachte Sorgfaltspflichten für Rohstoffe aus Ländern oder Regionen mit geringem Risiko ermöglicht. Dieses System soll den Verwaltungsaufwand für Unternehmen bei der Beschaffung aus Gebieten mit geringerer Wahrscheinlichkeit von Entwaldung oder Gesetzesverstößen reduzieren und gleichzeitig die Integrität und Ziele der Verordnung wahren.
Risikokategorien
Um dies umzusetzen, wird die EU Länder oder subnationale Regionen in drei verschiedene Risikostufen einteilen:
- Geringes Risiko: Dies sind Gebiete, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Abholzung geringer ist und die gesetzlichen Standards besser eingehalten werden.
- Standardrisiko: Dies stellt die Grundstufe dar, die von Unternehmen die vollständige Erfüllung der in der Verordnung beschriebenen Sorgfaltspflicht verlangt.
- Hohes Risiko: In Gebieten dieser Kategorie ist aufgrund des erhöhten Risikos einer Waldschädigung oder einer Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften eine verstärkte Sorgfaltspflicht erforderlich.
Diese Klassifizierungen werden voraussichtlich bis spätestens 30. Juni 2025 von der Europäischen Kommission veröffentlicht. Bis dahin wird Unternehmen empfohlen, alle Quellen entweder als Standard- oder Hochrisikoquellen einzustufen und die erforderlichen Prüfungen entsprechend durchzuführen.
Vorteile der Niedrigrisikoklassifizierung
Wenn ein Land oder eine Region offiziell als risikoarm eingestuft wird, profitieren Unternehmen, die Rohstoffe aus diesen Gebieten beziehen, von einem deutlich vereinfachten Due-Diligence-Prozess. Ein wesentlicher Vorteil ist der Verzicht auf umfassende Risikobewertungen. Da die Wahrscheinlichkeit von Abholzung oder Gesetzesverstößen als gering eingeschätzt wird, sind Unternehmen nicht verpflichtet, die gleichen umfassenden Bewertungen durchzuführen, die für Regionen mit höherem Risiko vorgeschrieben sind.
Darüber hinaus sind Minderungsverfahren – die zeit- und ressourcenintensiv sein können – bei Quellen mit geringem Risiko in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, es treten konkrete Bedenken oder Warnsignale auf. Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Compliance-Bemühungen effizienter einsetzen und ihre Ressourcen auf Lieferanten oder Regionen mit höheren Risiken konzentrieren können. Insgesamt kann die Beschaffung aus Ländern mit geringem Risiko Unternehmen helfen, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
Mindestanforderungen gelten weiterhin
Trotz der geringeren Belastung für Gebiete mit geringem Risiko schreibt die EU-Verordnung weiterhin bestimmte Mindestanforderungen an die Sorgfaltspflicht vor, die von allen Unternehmen unabhängig von der Risikoklassifizierung des Herkunftslandes erfüllt werden müssen. So sind Unternehmen verpflichtet, Geolokalisierungsdaten der Länder zu erfassen, aus denen ihre Waren stammen. Dies gewährleistet die Rückverfolgbarkeit und unterstützt die umfassenderen Ziele der EU zur Überwachung der Entwaldung.
Darüber hinaus müssen Unternehmen formelle Due-Diligence-Erklärungen einreichen, um ihre Einhaltung der Verordnung zu bestätigen. Diese Erklärungen dienen als rechtliche Bestätigung dafür, dass die Produkte den EUDR-Standards entsprechen. Schließlich müssen alle Belege mindestens fünf Jahre lang sicher aufbewahrt werden. Diese Archivierungspflicht stellt sicher, dass die Daten im Falle einer Prüfung oder behördlichen Anfrage zur Überprüfung verfügbar sind. Obwohl der Prozess für Länder mit geringem Risiko vereinfacht werden kann, bleibt die Verpflichtung zu Transparenz und Rechenschaftspflicht unverändert.
Strafen bei Nichteinhaltung
Die EUDR ist mit einem strengen Durchsetzungsregime verbunden, das die Einhaltung nicht nur zu einer gesetzlichen Anforderung, sondern auch zu einer geschäftlichen Notwendigkeit macht. Die Nichterfüllung der Verpflichtungen kann schwerwiegende finanzielle und rufschädigende Folgen haben.
Arten von Durchsetzungsmaßnahmen
Die EU-Mitgliedstaaten sind für die Durchsetzung der Verordnung durch eine Kombination aus risikobasierten Inspektionen, Dokumentenprüfungen und Audits, Vor-Ort-Überprüfungen sowie Probenahmen und Tests von Waren verantwortlich. Diese Kontrollmechanismen stellen sicher, dass Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten gemäß der EU-Verordnung nachkommen.
Finanzielle und rechtliche Strafen
Zu den Strafen bei Nichteinhaltung der EUDR gehören:
- Geldbußen: Bis zu 41 TP3T des gesamten EU-Umsatzes des Unternehmens im vorangegangenen Geschäftsjahr.
- Produktbeschlagnahme: Sofortige Beschlagnahme nicht konformer Waren.
- Beschlagnahmung von Einnahmen: Die Behörden können Gewinne aus nicht konformen Produkten zurückfordern.
Diese Geldbußen stehen im Verhältnis zum Umweltschaden und zum wirtschaftlichen Wert der betroffenen Produkte.
Zusätzliche Konsequenzen
Die Folgen von Verstößen gehen über finanzielle Verluste hinaus. Unternehmen können Marktzugangsbeschränkungen unterliegen, darunter ein vorübergehendes oder dauerhaftes Verbot der Wareneinführung auf dem EU-Markt und die Aussetzung von Export- oder Importlizenzen. Auch öffentliche Ausschreibungen können verboten werden, wodurch Unternehmen bis zu zwölf Monate lang von der Teilnahme an EU-finanzierten Aufträgen oder Lieferketten ausgeschlossen werden. Am schädlichsten ist möglicherweise das Risiko der öffentlichen Bekanntmachung: Die Europäische Kommission kann Verstöße auf ihrer Website öffentlich machen und dabei den Namen des Unternehmens, eine Zusammenfassung des Verstoßes und die verhängten Sanktionen auflisten. Diese Sichtbarkeit kann die Glaubwürdigkeit einer Marke schädigen, Investoren abschrecken und wichtige Geschäftspartnerschaften gefährden.
So vermeiden Sie Strafen
Um das Risiko von Strafen zu verringern, sollten Unternehmen:
- Führen Sie regelmäßige interne Audits der Due-Diligence-Systeme durch.
- Überwachen Sie die Einhaltung der Vorschriften durch Lieferanten genau, insbesondere in Hochrisikoländern.
- Führen Sie detaillierte, zugängliche Aufzeichnungen aller Geolokalisierungs- und Beschaffungsdaten.
- Bleiben Sie über Risikoklassifizierungen und regulatorische Aktualisierungen auf dem Laufenden.
Arbeiten Sie mit Rechtsberatern oder EUDR-Beratern zusammen, um eine kontinuierliche Abstimmung sicherzustellen.
So bereiten Sie sich auf die EUDR vor
Da die Fristen näher rücken, ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Ein reaktiver Ansatz reicht nicht aus, insbesondere angesichts der notwendigen Dokumentations- und Systemüberholungen.
Schritt-für-Schritt-Vorbereitungsplan:
- Bilden Sie Ihre Lieferkette ab: Identifizieren Sie, welche Produkte unter die EUDR fallen, und verfolgen Sie sie bis zu ihrer Quelle.
- Bewerten Sie die Bereitschaft der Lieferanten: Arbeiten Sie mit Lieferanten zusammen, um Geolokalisierungsdaten zu erfassen und die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.
- Bauen Sie Ihr Compliance-Team auf: Weisen Sie intern Verantwortlichkeiten zu und klären Sie die Mitarbeiter über die gesetzlichen Verpflichtungen auf.
- Datensysteme einrichten: Implementieren Sie Tools zum sicheren Sammeln, Überprüfen und Speichern der erforderlichen Informationen.
- Erstellen Sie ein Due-Diligence-System: Definieren Sie, wie Sie Risiken bei Lieferanten und Produkten bewerten und mindern.
- Erstellen und Einreichen von Due-Diligence-Erklärungen: Nutzen Sie das Informationssystem der EU, das am 4. Dezember 2024 eingeführt wurde.
- Planen Sie die jährliche Berichterstattung: Aufzeichnungen fünf Jahre lang aufbewahren und ab 2025 öffentlich berichten.
Herausforderungen und praktische Überlegungen
Die Anpassung an die EUDR ist keine einfache Aufgabe. Unternehmen jeder Größe und Branche stehen vor technischen und strategischen Herausforderungen. Diese variieren je nach Komplexität ihrer Lieferketten, den verarbeiteten Rohstoffen und regionalen Faktoren, die Produktion und Beschaffung beeinflussen.
Komplexität der Datenerfassung
In Sektoren wie der Landwirtschaft sind Lieferketten oft fragmentiert und umfassen zahlreiche Kleinbauern. Die Datenerfassung von Hunderten oder gar Tausenden von Produzenten stellt erhebliche logistische und organisatorische Hürden dar. Unternehmen müssen mehrere wichtige Datenpunkte erfassen und überprüfen, darunter die Geolokalisierung der Anbauflächen, den Zeitpunkt der Ernte oder Produktion, das Herkunftsland und die geltenden Rechtsvorschriften, Lieferantenidentitäten, Transaktionsaufzeichnungen und Produktspezifikationen wie Volumen und Warenart.
Diese Anforderungen werden durch reale Hindernisse noch weiter verkompliziert. Viele Produzenten, insbesondere in ländlichen oder Entwicklungsregionen, führen keine digitalen Aufzeichnungen und haben keinen Zugang zu GPS-Geräten. Auch Sprach- oder Lesebarrieren können das Verständnis der Anforderungen an die Geodatenkartierung beeinträchtigen. In manchen Regionen erschwert eine schlechte Internetverbindung die digitale Datenerfassung und -übermittlung, was die Rückverfolgbarkeit zusätzlich erschwert.
Zusammenarbeit und Bereitschaft der Lieferanten
Viele Vorlieferanten – insbesondere solche mit Sitz außerhalb der EU – sind mit der EU-Verordnung nicht vertraut und möglicherweise nicht darauf vorbereitet, deren Anforderungen zu erfüllen. Ihnen fehlt oft das Bewusstsein für die Verordnung, sie nutzen keine digitalen Tools zur Datenerfassung und verfügen über kein Personal für Compliance- oder Nachhaltigkeitsfunktionen. Diese Kapazitätslücken können den Aufbau nachvollziehbarer, konformer Lieferketten erheblich verlangsamen.
Lösungen zur Förderung der Compliance
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, können Unternehmen verschiedene praktische Schritte unternehmen, um das Engagement ihrer Lieferanten zu verbessern und ihre Bereitschaft zur Einhaltung der EUDR zu erhöhen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, Wissens- und Kapazitätslücken zu schließen, insbesondere bei Kleinbauern und Produzenten außerhalb der EU.
- Erstellen Sie Schulungsprogramme für LieferantenDiese Programme sollten die EUDR-Anforderungen anhand praktischer Beispiele und lokal relevanter Szenarien klar erläutern. Die Schulung kann in Form von Workshops, Online-Modulen oder in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen durchgeführt werden.
- Bieten Sie Compliance-Toolkits in der Landessprache ans. Toolkits können Checklisten, Vorlagen, mobile Apps und visuelle Anleitungen enthalten, die die Datenerfassung und Berichterstattung vereinfachen. Lokalisierung ist der Schlüssel zur Gewährleistung der Zugänglichkeit und des effektiven Verständnisses.
- Bieten Sie finanzielle oder technische Anreize für Verbesserungen der Rückverfolgbarkeit. Anreize wie die Kostenbeteiligung für GPS-Geräte, mobile Datenkontingente oder der Zugang zu Rückverfolgbarkeitssoftware können Lieferanten dazu ermutigen, die notwendigen Tools und Systeme einzuführen.
- Zusammenarbeit mit Branchenverbänden zur Standardisierung der Datenerfassung. Eine branchenweite Zusammenarbeit kann dazu beitragen, Anforderungen anzugleichen, Doppelarbeit zu vermeiden und den Compliance-Aufwand für Hersteller, die mehrere Käufer beliefern, zu verringern.
Diese Schritte erfordern zwar anfängliche Investitionen, können jedoch die Transparenz der Lieferkette erheblich verbessern und die langfristige Einhaltung der EUDR-Anforderungen sicherstellen.
Technologieinvestitionen
Die Umsetzung der EUDR erfordert erhebliche Investitionen in die Dateninfrastruktur. Unternehmen müssen Systeme einführen oder aktualisieren, die Folgendes ermöglichen:
- Verfolgung der Rohstoffherkunft vom Grundstück bis zum Produkt.
- Speichern und Verwalten von Geolokalisierungs- und Transaktionsdaten.
- Integration von Satellitenbildern oder Waldüberwachungstools.
- Erstellen und Einreichen von Due-Diligence-Erklärungen.
Strategische Investitionsbereiche könnten Rückverfolgbarkeitsplattformen wie Sourcemap oder Open Supply Hub sein, die es Unternehmen ermöglichen, mehrstufige Lieferketten zu visualisieren und zu verwalten. Andere nutzen Anbieter von Fernerkundungssystemen wie Global Forest Watch oder Satelligence, um Abholzungswarnungen in Echtzeit zu überwachen. Blockchain-basierte Systeme (z. B. Circulor, Provenance) erfreuen sich aufgrund ihrer manipulationssicheren Rückverfolgbarkeit ebenfalls zunehmender Beliebtheit.
Darüber hinaus implementieren Unternehmen Portale für die Einarbeitung und Schulung von Lieferanten, integrieren Rückverfolgbarkeitssysteme in ERP-Plattformen und nutzen ESG-Dashboards zur Überwachung der Compliance-Performance. Diese Tools tragen dazu bei, den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Datenkonsistenz abteilungsübergreifend sicherzustellen.
Durch den Einsatz erprobter, skalierbarer Technologien können Unternehmen zukunftssichere Systeme aufbauen, die nicht nur die Einhaltung der EUDR gewährleisten, sondern auch die Nachhaltigkeitspraktiken insgesamt stärken.
Angleichung an andere ESG-Vorschriften
Viele Unternehmen, die der EUDR unterliegen, unterliegen zudem sich überschneidenden ESG-Rahmenwerken wie der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), der Richtlinie zur Sorgfaltspflicht in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSDDD) und der Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (NFRD). Die Abstimmung der EUDR-Bemühungen mit diesen Rahmenwerken kann die Duplizierung der Berichterstattung reduzieren, die Datenerhebung und -validierung optimieren, Investoren und Kunden eine einheitliche ESG-Botschaft präsentieren und die allgemeine Risikotransparenz verbessern.
Die Rolle externer Berater
Für viele Unternehmen – insbesondere solche ohne eigene ESG-Teams oder Erfahrung im Management globaler Lieferketten – kann die Zusammenarbeit mit externen Beratern während des gesamten EUDR-Compliance-Prozesses eine entscheidende Unterstützung darstellen.
Diese Experten unterstützen bei:
- Abbildung von Lieferketten und Identifizierung von Beschaffungsregionen mit hohem Risiko.
- Interpretation lokaler Rechtsrahmen zur Beurteilung von Landbesitz-, Umwelt- und Arbeitsgesetzen.
- Einrichten konformer Datensysteme, einschließlich Erfassung und Speicherung der Geolokalisierung.
- Schulung interner Mitarbeiter und Lieferanten zu den Anforderungen und Dokumentationsverfahren der EUDR.
- Überprüfen und Validieren von Daten, um sicherzustellen, dass die Rückverfolgbarkeit genau und prüfungsbereit ist.
Berater helfen zudem, häufige Fehler zu vermeiden, wie etwa das Vertrauen auf nicht überprüfbare Lieferantenerklärungen, die Unterschätzung von IT-Systemanforderungen oder die falsche Einstufung von Produktrisiken. Durch die frühzeitige Einbindung externer Expertise können Unternehmen die Implementierung optimieren, Compliance-Kosten senken und sich besser auf Audits und Durchsetzungsmaßnahmen vorbereiten.
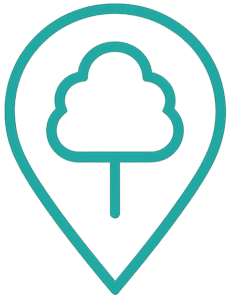
Benötigen Sie Hilfe bei der Einhaltung der EUDR?
Die Einhaltung der EU-Entwaldungsverordnung ist komplex – und Fehler können kostspielig sein. Versuchen Sie EUDR.co – Wir unterstützen Unternehmen jeder Größe dabei, ihre EUDR-Verpflichtungen klar und zuverlässig zu erfüllen. Von der Erfassung von Geolokalisierungsdaten und der Abbildung der Lieferkette bis hin zur Risikobewertung und Due-Diligence-Berichterstattung bieten wir kompetente Beratung, Tools und maßgeschneiderte Ressourcen, die den gesamten Compliance-Prozess vereinfachen.
Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, strenge gesetzliche, ökologische und Rückverfolgbarkeitsstandards einzuhalten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Sie vor der Umsetzungsfrist im Dezember 2025 optimal vorbereitet sind. Mit EUDR.co erfüllen Sie nicht nur die Anforderungen – Sie sind ihnen immer einen Schritt voraus.
Schlussfolgerung
Die EU-Entwaldungsverordnung ist nicht nur ein weiterer bürokratischer Aufwand – sie verändert den Welthandel grundlegend. Indem sie den Nachweis verlangt, dass Produkte ohne Entwaldung, legal hergestellt und vollständig rückverfolgbar sind, verlangt die EU-Verordnung ein neues Maß an Rechenschaftspflicht von Unternehmen, die risikoreiche Rohstoffe beschaffen, herstellen oder mit ihnen handeln.
Da die Fristen 2025 und 2026 näher rücken, bleibt Unternehmen nur noch wenig Zeit zum Handeln. Wer frühzeitig handelt, in intelligente Rückverfolgbarkeitssysteme investiert und transparent mit Lieferanten umgeht, vermeidet nicht nur Strafen, sondern verschafft sich auch einen echten Wettbewerbsvorteil. Bei der Einhaltung der EUDR geht es nicht nur um Risikovermeidung, sondern auch um den Aufbau einer stärkeren und nachhaltigeren Geschäftsbasis für die Zukunft.
Häufig gestellte Fragen
1. Geht es bei der EUDR nur um die Einhaltung von Umweltvorschriften?
Nein, die EUDR beinhaltet auch Elemente sozialer Verantwortung. Unternehmen müssen nicht nur nachweisen, dass ihre Produkte ohne Abholzung auskommen, sondern auch, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen im Herkunftsland erfüllen, einschließlich Arbeitsrechten und Landrechten, insbesondere im Hinblick auf indigene Gemeinschaften.
2. Was passiert, wenn ein Lieferant keine Geolokalisierungsdaten bereitstellen kann?
In diesem Fall darf das Produkt nicht auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht oder dorthin exportiert werden. Die Geolokalisierung ist ein obligatorisches Element der Sorgfaltspflicht. Fehlt sie, wird die Lieferung automatisch als nicht konform eingestuft.
3. Müssen alle Unternehmen ab 2025 die Vorschriften einhalten?
Nein. Große und mittelgroße Betreiber und Händler müssen die Vorschriften bis zum 30. Dezember 2025 einhalten. Kleine und Kleinstunternehmen haben bis zum 30. Juni 2026 Zeit. Unabhängig von der Größe ist jedoch eine frühzeitige Vorbereitung dringend zu empfehlen.
4. Wird die Liste der regulierten Rohstoffe erweitert?
Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Die Europäische Kommission wird die Liste der Rohstoffe bis Mitte 2025 überprüfen und möglicherweise erweitern. Mais, Biokraftstoffe, Zuckerrohr und Textilfasern wie Viskose werden bereits in Betracht gezogen.
5. Können Zertifizierungen durch Dritte die EUDR-Due-Diligence ersetzen?
Nein. Zertifizierungen können zwar die Risikobewertung unterstützen, ersetzen aber nicht die gesetzliche Verpflichtung zur umfassenden Sorgfaltspflicht gemäß der EU-Verordnung. Die Beweislast liegt ausschließlich beim Unternehmen, das das Produkt auf den EU-Markt bringt.
6. Wie werden die Aufsichtsbehörden die Einhaltung überprüfen?
Mithilfe von Satellitenüberwachung, Lieferantenaudits, Dokumentenprüfungen und Inspektionen vor Ort werden die Behörden beurteilen, ob die Sorgfaltspflichtsysteme funktionieren und ob die Unternehmen ihren Verpflichtungen nachkommen.
7. Gibt es für Unternehmen, die ihre Waren aus Ländern mit geringem Risiko beziehen, eine gewisse Flexibilität?
Ja. Wenn ein Land oder eine Region als risikoarm eingestuft wird, können Unternehmen ein vereinfachtes Due-Diligence-Verfahren durchführen. Sie müssen jedoch weiterhin Geolokalisierungsdaten erfassen und Due-Diligence-Erklärungen einreichen.
